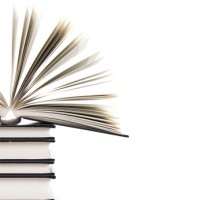Was können wir am PC reparieren?
Dienstag, April 21, 2015
Am Ende des Fehlersuchprozesses haben Sie die Fehlerquelle oder Fehlerursache soweit bestimmt, dass Sie mit der Fehlerbeseitigung (Instandsetzung) beginnen können. Nach dem gleichsam klassischen Verständnis wird die Fehlerursache bis zur kleinsten reparierbaren Einzelheit oder bis zum kleinsten austauschbaren Bauelement verfolgt.
Dieses Vorgehen ist üblich, seit es überhaupt technische Einrichtungen gibt. Der Uhrmacher hat nicht die Uhr weggeworfen, sondern das defekte Zahnrad oder den defekten Lagerstein ausgewechselt. Der Rundfunkmechaniker hat das Radio durch Festlöten eines Drahtes, durch Austauschen der defekten Röhre usw. wieder zum Spielen gebracht. In den Betriebs- und Ausbesserungswerken der Eisenbahn wurden Kuppelstangen gerichtet, Lager neu ausgegossen und Zylinder ausgedreht. Es war Ehrensache, nur das wegzuwerfen, was man wirklich nicht mehr zum Gebrauch herrichten konnte. Können wir beim PC auch soweit gehen?
Grundsätzlich: jein. Nein, sofern es sich um Bauelemente handelt, die fertigungstechnisch eine Ganzheit bilden. Es ist offensichtlich, dass man einen defekten Schaltkreis nicht reparieren kann (schließlich konnte auch der findigste Rundfunkmechaniker keine Röhre reparieren oder gar selbst herstellen).
Ansonsten kommt es nur auf die Kosten an. Das Geheimnis der preisgünstigen PC-Hardware ist die Massenfertigung der Bauelemente, Funktionseinheiten und Baugruppen (Schaltkreise, Laufwerke, Tastaturen, Netzteile, Gehäuse usw.). Dies erfordert äußerst kostspielige Aufwendungen und hochentwickelte Technologien. Entscheidend für uns ist der sehr große Unterschied zwischen den technologischen Möglichkeiten des Herstellers und des reparierenden Technikers. Und genau das ist bei der „klassischen” Technik nicht in diesem Ausmaß der Fall; hier werden in Herstellung und Reparatur vielfach gleiche oder ähnliche Werkzeuge und Verfahren verwendet (auch in der Reparaturwerkstatt kann man ein Gewinde schneiden oder ein Zahnrad fräsen).
Das Reparieren im klassischen Sinn, vor allem das Nacharbeiten und Nachfertigen, ist also weitgehend ausgeschlossen. Wir können so bestenfalls Bagatell- oder Trivialfehler beseitigen, z. B. „kalte” Lötstellen nachlöten. Alles andere läuft auf ein Austauschen hinaus.
Ausgewechselte Teile können wir selbst nicht mehr aufarbeiten. Komplette Baugruppen oder Funktionseinheiten kann man bisweilen an den Hersteller zwecks Reparatur einsenden; ansonsten verbleibt nur das Wegwerfen (vornehmer ausgedrückt: das Entsorgen).
Die Grundsatz-Frage für uns ist also, was wir als kleinste austauschbare Einheit ansehen. Gleich welche Festlegung wir treffen, müssen wir folgende Tatsachen berücksichtigen:
- Wir müssen imstande sein, die Fehlerursache bis auf die kleinste austauschbare Einheit zurückzuverfolgen (Fachbegriff: Fehlerlokalisierung). Das erfordert Messmittel, Dokumentation, Fachwissen und Arbeitszeit.
- Wir müssen imstande sein, die gefundene Einheit zu entfernen und die neue einzubauen. Das kann gelegentlich Sonderwerkzeuge erfordern; wenn es um Schaltkreise und andere elektronische Bauelemente geht, auch Lötvorgänge. Heutzutage reicht der gewohnte Lötkolben nur noch in wenigen Fällen aus. Manche Bauelemente (z. B. Steuerschaltkreise auf Motherboards) sind mit werkstattüblichen Mitteln gar nicht auszuwechseln.
- Es muss möglich sein, die entsprechenden Ersatzteile auch kurzfristig zu beziehen. Es hat keinen Sinn, die Fehlerursache bis auf ein bestimmtes Einzelteil genau zu lokalisieren, wenn wir niemanden finden, der ein solches Teil umgehend liefert.